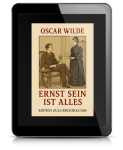 Oscar Wildes Komödie „Ernst sein ist alles“ (im Original The Importance of Being Earnest, 1895) ist eine der brillantesten Satiren der englischen Literatur. Hinter ihrem heiteren Witz verbirgt sich eine scharfe Kritik an der Heuchelei der viktorianischen Gesellschaft. Schon der Titel ist ein Sprachspiel: „Ernst“ – im Englischen zugleich der Vorname Ernest – wird zum Symbol für die Doppelmoral einer Welt, in der Ansehen wichtiger ist als Aufrichtigkeit.
Jack Worthing und Algernon Moncrieff erfinden beide Alter Egos, um den Zwängen der Gesellschaft zu entfliehen. Als sie – beide unter dem Namen „Ernest“ – um die Gunst zweier Damen werben, entspinnt sich ein komödiantisches Verwirrspiel voller Täuschungen, Enthüllungen und pointierter Dialoge. Wilde entfesselt eine Feuerwerkskunst des Wortes: Bonmots, Paradoxien und elegante Bosheiten prasseln wie Musik aufeinander.
Doch unter der Leichtigkeit liegt eine bittere Wahrheit: Der Wunsch, „ernst“ zu erscheinen, verdrängt das Bedürfnis, wahrhaft zu sein. Wilde entlarvt die Scheinheiligkeit einer Gesellschaft, in der Moral nur Maske ist – und das Theater selbst zum Spiegel wird. Die Sprache ersetzt das Gefühl, das Kostüm die Seele.
So bleibt „Ernst sein ist alles“ bis heute ein Meisterwerk der Ironie – eine Gesellschaftskomödie, die mit feiner Klinge seziert, was wir für Ernst halten, und zeigt, dass nichts komischer ist als der Versuch, moralisch zu wirken. |
 Oscar Wilde (1854–1900)
Oscar Wilde (1854–1900)
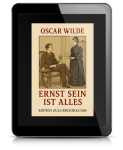
 Oscar Wilde
Oscar Wilde Deutsch
Deutsch
 17.10.2025
17.10.2025 779.77 KB
779.77 KB 87
87 168
168